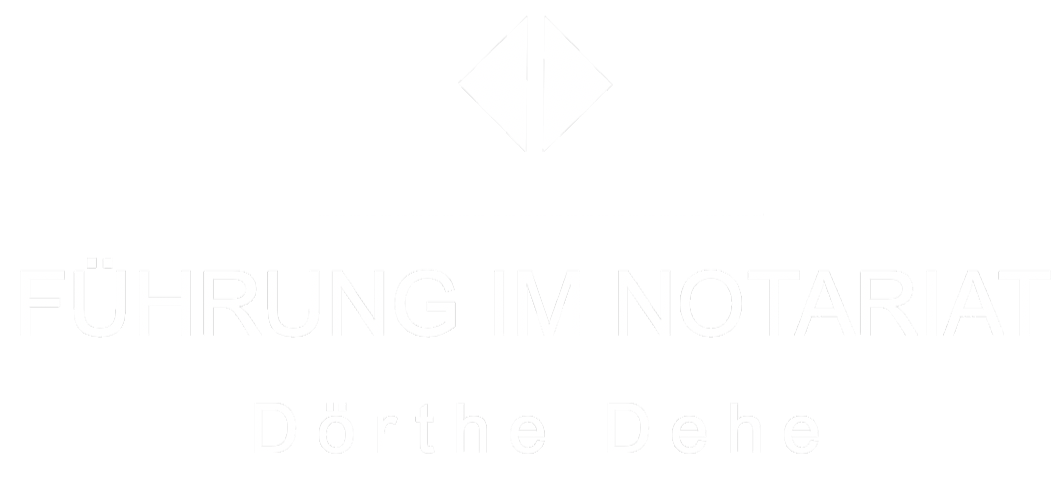Du hast den ganzen Tag durchgearbeitet. Abends am Schreibtisch triffst du auf eine unbequeme Wahrheit: Nichts hat sich wirklich bewegt. Die Verträge sind beurkundet, die Mandantengespräche gelaufen, alles Dringende ist raus – und trotzdem ist nichts vorangekommen. Nicht wirklich.
Das Problem liegt selten darin, dass wir nicht wissen, was zu tun wäre. Es liegt darin, aus welchem inneren Zustand heraus wir handeln. Wenn Druck, Gewohnheit und Reflexe den Takt vorgeben, verengt sich unser Blickfeld. Wir verwalten dann nur noch, statt zu gestalten.
Vier innere Muster sind dabei besonders wirksam. Sie fühlen sich vernünftig an, sind sozial akzeptiert – und lähmen trotzdem deine Handlungsfähigkeit. Die gute Nachricht: Du kannst sie auflösen. Nicht mit großen Gesten oder Wochenend-Workshops, sondern mit klaren Schritten, die in deinen vollen Kanzleialltag passen.
Saboteur 1: Die Zeitfalle – oder warum das Dringende immer gewinnt
„Ich würde ja gerne, aber ich habe einfach keine Zeit.“ Dieser Satz klingt wie eine Tatsache. Ist er aber nicht. Er ist eine Kapitulation vor dem Dringenden. Abends bist du erschöpft, nicht weil du faul warst, sondern weil du den ganzen Tag auf Zuruf gearbeitet hast. Die spontane Mandantenanfrage. Das dringende Testament. Die kurzfristige Terminabstimmung. Das Wichtige wurde verschoben. Wieder.
Die Planung der nächsten Teamentwicklung? Nächste Woche. Die Überarbeitung der internen Abläufe? Steht auf der Liste. Die Fortbildungsplanung fürs Team? Wenn mal Ruhe ist.
Forschung zeigt: Zeitdruck senkt die Qualität bei allem, was nicht Routine ist. Ohne aktiven Schutz rutscht jede geplante Verbesserung vom Tisch. Die Lösung ist kein Zeitmanagement-Seminar, sondern Handwerk.
Dein Aktionsplan:
Nimm dir eine Stunde Zeit, um ein großes Vorhaben in drei handfeste Teilprobleme zu zerlegen. Nicht mehr. Beispiel Digitalisierung des Urkundenarchivs: „Konzept für Scanprozess erstellen“, „Schulung des Teams zu elektronischer Akte“, „Pilotphase mit 50 Altakten starten“.
Wähle ein Teilproblem und leg einen zweiwöchigen Sprint dafür fest – das heißt: Du arbeitest zwei Wochen lang fokussiert an diesem einen Teilproblem, mit einem klaren Endzeitpunkt. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt: Du sicherst dir diese Zeit mit einem Wenn-dann-Plan. „Wenn es Donnerstag 9 Uhr ist, dann arbeiten wir 90 Minuten am Scanprozess-Konzept. Das Telefon ist umgeleitet, der Kalender ist blockiert.“
Solche Implementierungs-Intentionen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Geplantes tatsächlich geschieht, nachweislich um das Drei- bis Vierfache. Nicht, weil du motivierter bist, sondern weil die Entscheidung schon gefallen ist.
Am Ende des Sprints: eine kurze Auswertung. Was behalten wir? Was ändern wir? Was beenden wir? Und: Welchen sichtbaren Zeitdieb streichen wir jetzt? Die doppelte Prüfung von Standardverträgen? Die CC-Flut bei jedem Vorgang?
Zeit entsteht nicht dadurch, dass sie übrig ist. Sie entsteht, weil du sie schützt.
Saboteur 2: Die Alternativlosigkeit – oder warum wir im Bekannten stecken bleiben
Wenn sich die Lage unsicher anfühlt, tun wir instinktiv mehr von dem, was wir kennen. Mehr Kontrolle. Mehr Rückfragen. Mehr Prüfschleifen. Es fühlt sich nach Sorgfalt an, weil Bewegung entsteht. Aber die Situation verbessert sich kaum.
Das ist kein Charakterfehler, sondern Psychologie: Bedrohung verengt unser Suchfenster. Stell dir vor, die Mandantenanfragen häufen sich, weil Entwürfe fehlerhaft versandt werden. Dein erster Reflex? Noch mehr Kontrolle, noch detailliertere Prüfschleifen, noch engmaschigere Freigabeprozesse. Das Paradoxe: Je mehr du kontrollierst, desto langsamer wird das System – und die Fehlerquote sinkt kaum. Dieses Muster nennt die Forschung „Threat-Rigidity“ – Bedrohungsstarrheit. Unter Stress verengt sich unser Blick auf das, was wir bereits kennen. Neue Lösungen kommen gar nicht erst in Betracht. Dazu kommt der Status-quo-Bias: Unser Gehirn bevorzugt das Vertraute, selbst wenn es erkennbar nicht mehr funktioniert.
Dein Aktionsplan:
Der Ausweg beginnt nicht mit einem radikalen Kurswechsel, sondern mit bewusster Suchbewegung. Nimm dir eine Stunde Zeit und leg drei realistische Varianten auf den Tisch: Was könntest du weglassen? Was vereinfachen? Was verschieben?
Wähle eine Variante und teste sie in einem Mini-Pilot für zwei Wochen. Begrenze das Risiko radikal: ein Vertragstyp, eine Mitarbeiterin, ein Aufgabenbereich. Beispiel Entwurfsprüfung: Teste, ob eine Checkliste für Standardverträge (statt dreifacher Durchsicht) die Fehlerquote senkt und gleichzeitig Zeit spart.
Und miss möglichst konkret:
- Wie viele Fehler werden im Entwurf übersehen und später reklamiert?
- Wie lange dauert die durchschnittliche Entwurfsprüfung?
- Wie oft klappt der Versand eines Entwurfs beim ersten Anlauf – ohne Rückfragen oder Nachbesserungen?
Entscheidend ist psychologische Sicherheit: Sorge dafür, dass Einwände ausgesprochen werden dürfen. Ohne diesen Raum bleiben die besten Hinweise ungehört.
Nach zwei Wochen entscheidest du auf Basis der Daten, nicht der Gewohnheit: beibehalten, anpassen oder verwerfen. Nur ein sauberes Experiment.
Saboteur 3: Die Scheinstabilität – oder warum Erfolg blind macht
„Es läuft doch.“ Solange die Umsatzzahlen stimmen und die Mandate reinkommen, gelten Konflikte als Kollateralschaden. Korrekturen werden verschoben, weil der Laden ja läuft. Das ist verständlich – und gefährlich.
Denn die versteckten Kosten tauchen nicht in deiner Betriebswirtschaft auf: Fehler in Verträgen, die später auffallen. Doppelarbeit bei der Aktenprüfung. Wissensverlust, wenn erfahrene Mitarbeiterinnen gehen. Abwanderungsrisiko bei Talenten. Schwindendes Vertrauen im Team. Forschung zeigt klar: Beziehungs- und Aufgabenkonflikte mindern die Leistung messbar. Du siehst es nur nicht sofort.
Und oft geht es nicht nur um Arbeitsabläufe. Konflikte drehen sich häufig um zwischenmenschliche Dynamiken: Wer bekommt Aufmerksamkeit? Wessen Meinung zählt bei der Vertragsgestaltung? Wer wird von dir als Notar/Notarin gehört? Diese unsichtbaren Machtkämpfe kosten mehr Energie als jede ineffiziente Aktenablage.
Dein Aktionsplan:
Dringlichkeit entsteht, wenn Kosten sichtbar werden. Erstelle eine einfache Konfliktkarte. Nimm dir dafür eine Stunde:
- Wo reiben sich Zuständigkeiten aneinander? (Wer kümmert sich um Grundbuchanträge? Wer um Vollständigkeitsprüfung?)
- Welche Übergaben haken? (Von Entwurf zur finalen Fassung? Von Terminvorbereitung zur Beurkundung?)
- An welcher Schnittstelle entsteht Doppelarbeit? (Wird der gleiche Vertrag dreimal geprüft?)
- Und: Wo kämpfen Menschen um Anerkennung, Einfluss oder deine Aufmerksamkeit?
Ergänze deine Kennzahlen um das, was Konflikte sichtbar macht:
- Wie viele Klärungsschleifen braucht es, bis ein Vertragsentwurf finalisiert ist?
- Wie oft werden Aufgaben doppelt bearbeitet? (Prüfung, Grundbuchanträge, Mandanteninformation)
- Wie lange brauchen neue Notarfachangestellte, bis sie produktiv sind?
Diese Zahlen erzählen dir mehr über die Zukunft als der aktuelle Quartalsumsatz.
Führe die Beteiligten in kleinem Rahmen zusammen. Kläre das Zielbild. Dann benenne konkret, was einzelne Personen gut können und wo diese Stärke dem Team nützt. Nicht: „Sarah ist toll.“ Sondern: „Sarah kann schnell auf Makleranfragen reagieren. Das brauchen wir bei der Erstanfrage.“ Oder: „Michael erklärt Mandanten komplizierte Erbrechtskonstellationen so, dass sie es verstehen. Das entlastet uns alle bei Beratungsgesprächen.“ Solche gezielten Stärken einzusetzen, ist kein „Nice-to-have“, sondern ein Werkzeug, das Bindung und Leistung gleichzeitig stützt. Es nimmt auch Wind aus Machtkämpfen: Wer eine klare, anerkannte Rolle hat, muss nicht mehr um Aufmerksamkeit kämpfen.
Vereinbart zwei messbare Arbeitsregeln:
- Was heißt „fertig“? (Wann ist ein Vertragsentwurf bereit für die Beurkundung? Wann ist eine Akte vollständig?)
- Wer entscheidet was? (Wer gibt Verträge frei? Wer kommuniziert mit Mandanten bei Änderungen?)
- Wer informiert wen? (Wer erfährt von Terminverschiebungen? Wer wird bei Fristverlängerungen informiert?)
Nach vier Wochen prüfst du: Was hat sich verändert? Wo müssen wir nachschärfen? Sind die zwischenmenschlichen Spannungen gesunken?
Saboteur 4: Die Resignation – oder warum Vernunft lähmt
„Es hat eh keinen Sinn.“ Dieser Satz klingt realistisch. Vielleicht sogar weise. „Die Mandanten sind so.“ „Das Team ändert sich nicht.“ „Die Digitalisierung kommt sowieso nicht voran.“ Man spart sich kurzfristig die Enttäuschung – und bezahlt langfristig mit Handlungsunfähigkeit.
Die Psychologie nennt das „erlernte Hilflosigkeit“. Sie untergräbt Selbstwirksamkeit systematisch. Während Lernziele Ausdauer erhöhen und kleine Erfolge Momentum erzeugen, stoppt Resignation jede Bewegung.
Dein Aktionsplan:
Hoffnung ist kein weiches Gefühl, sondern eine Kombination aus Ziel, Weg und Beleg. Formuliere ein konkretes Zielbild: „Wir senken Nachfragen zu Ersteingängen in sechs Wochen um 30 Prozent.“
Definiere zwei konkrete Wege. Zum Beispiel: Automatische Eingangsbestätigung mit Erläuterungen zum Bearbeitungsprozess und ein Informationsblatt über die nächsten Schritte.
Entscheide, welche Frühindikatoren dir innerhalb einer Woche zeigen, ob ihr Fortschritt macht:
- Anzahl der Rückfragen zu Ersteingängen (täglich tracken)
- Durchschnittliche Zeit für Klärungsgespräche zu diesem Thema
- Anzahl der Fälle, die ohne Nachbesserung zur Beurkundung kommen
Erzähle die kleinen Fortschritte sichtbar im Team. Wer hat was ausprobiert? Was hat es gebracht? Was lassen wir bleiben? Diese regelmäßige, konkrete Rückmeldung ist kein Motivationsgag, sondern der Beweis, dass Veränderung möglich ist.
Nach sechs Wochen machst du einen ehrlichen Review: Was behalten wir? Was lassen wir? Was testen wir neu? Aus dieser stillen Disziplin entsteht das, was von außen „Hoffnung“ genannt wird.
Der Kern: Vom Reagieren zum Gestalten
Die vier Saboteure haben einen gemeinsamen Nenner: Sie halten dich in einem reaktiven Modus. Du schützt dich, statt zu gestalten. Du folgst Vorgaben, statt zu führen. Du antwortest auf Druck, statt zu entscheiden.
Der Wechsel heraus ist kein Motivationsschub, sondern eine Verschiebung des inneren Zustands. Von Fremdsteuerung zu innerer Klarheit. Von Selbstschutz zu Ergebnisfokus. Von Isolation zu Ausrichtung auf Menschen. Von Wiederholung zu konsequenter Lernbereitschaft.
Das ist keine Moralpredigt, sondern ein robustes Arbeitsprinzip: Wer Sinn und Integrität klärt, hört besser, entscheidet sauberer und macht Experimente, die der Kanzlei nützen. Die Aktionspläne oben verlangen keine Heldentaten. Sie verlangen Konsequenz. Und genau die ist in komplexen Kanzleistrukturen der wirksamste Hebel.
Zum Weiterlesen
Die beschriebenen Muster sind in der Organisations- und Führungsforschung gut dokumentiert. Wer tiefer einsteigen möchte:
Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493–503.
Edmondson, A. C. (1999). Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams. Administrative Science Quarterly, 44(2), 350–383.
Weick, K. E. (1984). Small wins: Redefining the scale of social problems. American Psychologist, 39(1), 40–49.
Staw, B. M., Sandelands, L. E. & Dutton, J. E. (1981). Threat rigidity effects in organizational behavior. Administrative Science Quarterly, 26(4), 501–524.
Samuelson, W. & Zeckhauser, R. (1988). Status quo bias in decision making. Journal of Risk and Uncertainty, 1(1), 7–59.
Baer, M. & Oldham, G. R. (2006). The curvilinear relation between experienced creative time pressure and creativity. Journal of Applied Psychology, 91(4), 963–970.
Payne, S. C., Youngcourt, S. S. & Beaubien, J. M. (2007). A meta-analytic examination of the goal orientation nomological net. Journal of Applied Psychology, 92(1), 128–150.
De Dreu, C. K. W. & Weingart, L. R. (2003). Task versus relationship conflict, team performance, and team member satisfaction. Journal of Applied Psychology, 88(4), 741–749.
Quinn, R. E. (2004). Building the Bridge as You Walk on It: A Guide for Leading Change. Jossey-Bass.