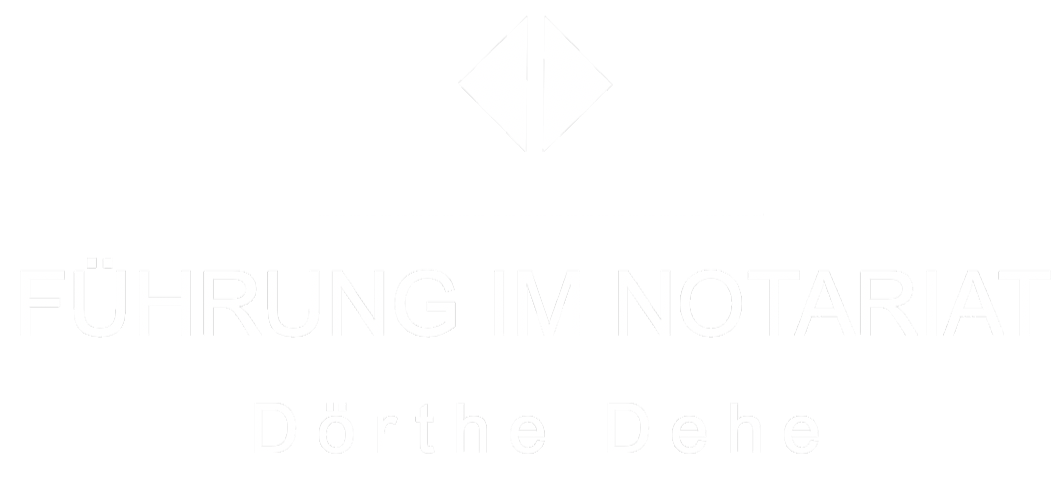„Ich dachte, das sei die beste Entscheidung – bis es schiefging.“
Diesen Satz höre ich oft in Coachings mit Führungskräften. Entscheidungen werden unter Druck getroffen, in Unsicherheit – oder einfach aus Gewohnheit. Was viele dabei unterschätzen: Unser Denken ist systematisch fehleranfällig.
Gerade für Führungskräfte, die täglich komplexe Entscheidungen treffen müssen, ist es entscheidend, typische Denkfehler zu kennen und sie gezielt zu vermeiden.
1. Warum wir so oft falsch entscheiden
Die Nobelpreisträger Daniel Kahneman und Amos Tversky haben mit ihrer Forschung zur Prospect Theory gezeigt: Unser Gehirn arbeitet in zwei Denksystemen.
- System 1 denkt schnell, automatisch, emotional. Es trifft rasche Entscheidungen – aber ist anfällig für kognitive Verzerrungen.
- System 2 denkt langsam, reflektiert und logisch. Es prüft, analysiert, wägt ab – braucht dafür aber Energie und Zeit.
Unter Zeitdruck, Stress oder Komplexität übernimmt fast immer System 1. Das ist effizient – aber riskant. Denn es führt uns oft zu voreiligen, unausgereiften Urteilen.
2. Zwei einfache Strategien gegen Denkfehler
Was hilft, wenn wir bewusstere, tragfähigere Entscheidungen treffen wollen? Zwei praxiserprobte Tools aus der psychologischen Entscheidungsforschung:
Consider the opposite
Stellen Sie sich gezielt die Frage:
Was, wenn das Gegenteil meiner Annahme wahr ist?
Dieser kognitive Perspektivwechsel reduziert confirmation bias, also die Tendenz, nur das zu sehen, was ins eigene Weltbild passt.
Advocatus Diaboli
Binden Sie eine kritische Gegenstimme ein – ob im Team oder in Form einer inneren Haltung.
Sich selbst (oder anderen) klug zu widersprechen, schärft die Argumentation und schützt vor Gruppendenken (groupthink).
3. Veränderung gelingt nur ohne Reaktanz
Ein häufiger Denkfehler in der Führung: „Wenn ich es logisch erkläre, wird es schon akzeptiert.“
Doch so funktioniert menschliches Verhalten nicht. Menschen sträuben sich gegen Veränderung, wenn sie sich fremdbestimmt fühlen. Die Psychologie nennt das Reaktanz: ein innerer Widerstand gegen wahrgenommene Bevormundung.
Deshalb gilt: Wer Wahlmöglichkeiten bietet statt Anweisungen, stärkt die Autonomie und erhöht die Veränderungsbereitschaft.
4. Probabilistisches Denken: Realistisch bleiben, Optionen sehen
Gerade in unklaren oder emotional aufgeladenen Situationen hilft ein Denkstil, der Wahrscheinlichkeiten einbezieht, ohne in Pessimismus oder Wunschdenken zu verfallen. Die Psychologie spricht hier von probabilistischem Denken – also der Fähigkeit, in Wahrscheinlichkeiten statt in Gewissheiten zu denken.
Dieser Denkstil stärkt die kognitive Flexibilität und reduziert Entscheidungsfehler – etwa durch:
- Realistische Einschätzungen: Was ist wahrscheinlich? Welche Risiken sind tatsächlich relevant?
- Offenheit für Optionen: Welche positiven Entwicklungen könnten ebenfalls eintreten?
- Transparente Kommunikation: Was ist gesichert – und wo besteht Unsicherheit?
Die Forschung (z. B. Stanovich & West, 2000; Gigerenzer, 2007) zeigt: Wer trainiert ist, Wahrscheinlichkeiten zu denken und Ambivalenz auszuhalten, trifft in komplexen Lagen deutlich bessere Entscheidungen.
Nicht weil sie perfekt wären, sondern weil sie reflektiert, flexibel und tragfähig sind.
5. Coaching statt Kontrolle
Ein Coaching-Impuls aus der Praxis:
Veränderung beginnt selten mit dem Satz „Du solltest …“.
Stattdessen helfen Fragen, die erste Schritte ermöglichen – ohne zu moralisieren.
Denn Menschen lernen am nachhaltigsten, wenn sie sich selbstwirksam erleben. Nicht durch Druck, sondern durch Klarheit, Resonanz und echte Wahlfreiheit.
6. Blinde Flecken erkennen – und testen
Viele Fehlentscheidungen entstehen in unbekannten Situationen. Umso wichtiger ist es, bewusst gegen die eigenen blinden Flecken zu arbeiten:
- Bitten Sie aktiv um Feedback.
- Testen Sie Ihre Hypothesen – auch wenn es nur kleine Experimente sind.
- Sprechen Sie offen über „Baustellen“ statt über „Schwächen“. Das senkt die Verteidigung und öffnet Entwicklungsspielräume.
Fazit: Gute Entscheidungen brauchen Klarheit und die beginnt im Kopf
Denkfehler lassen sich nicht völlig vermeiden, aber bewusst erkennen und korrigieren. Wer regelmäßig inne hält, sich selbst hinterfragt und alternative Perspektiven zulässt, trifft fundiertere Entscheidungen.
Das heißt nicht, alles zu zerdenken. Sondern: die richtigen Fragen zu stellen, statt nur schnelle Antworten zu suchen.
Führung, Coaching und Selbstreflexion gelingen am besten, wenn wir Verantwortung mit Denkfreiheit verbinden. Nicht perfekt, aber klar, realistisch und wirksam.
Impuls für Sie:
- Welche Denkgewohnheit möchten Sie in dieser Woche ganz bewusst hinterfragen?
- Und wen möchten Sie einladen, Ihnen eine neue Perspektive zu zeigen?
Wenn Sie tiefer einsteigen möchten:
Ob als Führungskraft, Team oder Organisation – ich unterstütze Sie gern dabei, bessere Entscheidungen zu treffen, Denkfehler zu erkennen und Klarheit im Alltag zu gewinnen.
Lassen Sie uns ins Gespräch kommen.
Weiterführende Literatur:
Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, Straus and Giroux.
Gigerenzer, G. (2007). Bauchentscheidungen – Die Intelligenz des Unbewussten und die Macht der Intuition. Goldmann Verlag.
Stanovich, K. E. & West, R. F. (2000). Individual differences in reasoning: Implications for the rationality debate. Behavioral and Brain Sciences, 23(5), 645–665.
Moors, A., & Frijda, N. H. (2013). Emotion, appraisal, and goal-directed behavior. Emotion Review, 5(4), 267–272.